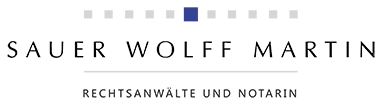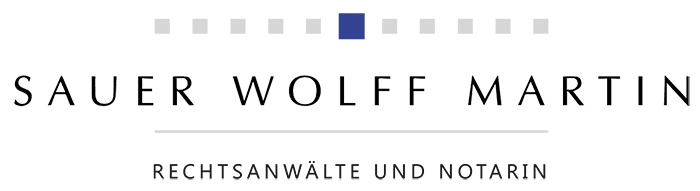Außergewöhnliche Belastung:
Nachweis bei Krankheitskosten: Name muss auf dem Kassenbeleg stehen
| Aufwendungen für Krankheitskosten sind nur als außergewöhnliche Belastung abziehbar, wenn gewisse Nachweiserfordernisse erfüllt sind. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat dargelegt, wie der Nachweis ab dem Veranlagungszeitraum 2024 zu führen ist. |
Hintergrund: Krankheitskosten können als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig sein.
Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf den Nachweis der Zwangsläufigkeit gelegt werden:
- Bei krankheitsbedingten Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel genügt es, wenn der Steuerpflichtige eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers vorlegt. Dies regelt § 64 Abs. 1 Nr. 1 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV).
- Bei bestimmten Krankheitskosten ist indes ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung erforderlich. Ein solcher qualifizierter Nachweis ist z. B. bei Aufwendungen für wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethoden, z. B. Frisch- und Trockenzellenbehandlungen, erforderlich (§ 64 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f EStDV).
Sind Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung einzustufen, wartet die Hürde der zumutbaren Belastung, deren Höhe von folgenden Faktoren abhängt:
- Gesamtbetrag der Einkünfte,
- Familienstand und
- Zahl der Kinder.
Erläuterungen des Bundesfinanzministeriums
Der Nachweis der Zwangsläufigkeit nach der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (hier: § 64 Abs. 1 Nr. 1 EStDV) ist bei einem eingelösten E-Rezept durch den Kassenbeleg der Apotheke bzw. durch die Rechnung der Online-Apotheke oder bei Versicherten mit einer privaten Krankenversicherung alternativ durch den Kostenbeleg der Apotheke zu erbringen.
Der Kassenbeleg (alternativ: die Rechnung der Online-Apotheke) muss folgende Angaben enthalten:
- Name der steuerpflichtigen Person,
- Art der Leistung (zum Beispiel Name des Arzneimittels),
- Betrag bzw. Zuzahlungsbetrag,
- Art des Rezeptes.
Beachten Sie | Zumindest für den Veranlagungszeitraum 2024 wird es vom BMF nicht beanstandet, wenn der Name der steuerpflichtigen Person nicht auf dem Kassenbeleg vermerkt ist.
Quelle | BMF-Schreiben vom 26.11.2024, IV C 3 – S 2284/20/10002 :005, Abruf-Nr. 245210 unter www.iww.de
Vermieter:
Erwerb einer Eigentumswohnung: anschaffungsnahe Herstellungskosten
| Nach dem Einkommensteuergesetz (hier: § 6 Abs. 1 Nr. 1a des EStG) werden Aufwendungen in Herstellungskosten umqualifiziert, wenn innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung des Gebäudes Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, deren Nettoaufwendungen 15 % der Gebäude-Anschaffungskosten übersteigen. Die Aufwendungen sind dann nicht sofort, sondern nur über die Gebäude-Abschreibung abzugsfähig. Bei einer Eigentumswohnung sind zwei Besonderheiten zu beachten, worauf das Finanzgericht (FG) Hessen hingewiesen hat. |
Hintergrund: Maßgebend sind die Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten der angeschafften Wohnung und nicht der Wert des Gesamtgebäudes. Bei Teil- und Wohnungseigentum ist danach die einzelne Einheit und nicht das Gesamtgebäude relevant.
Abzustellen ist auf die innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung der Wohnung angefallenen Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen des vermietenden Eigentümers einschließlich seiner anteiligen Aufwendungen für Arbeiten an den im Gemeinschaftseigentum stehenden Gebäudeteilen.
Beispiel
A erwirbt mit Wirkung zum 1.11.2023 eine Eigentumswohnung. Die Anschaffungskosten betragen insgesamt 300.000 Euro. Der Grund- und Bodenanteil beträgt 10 % = 30.000 Euro. Die Eigentumswohnung wird nach der Sanierung vermietet.
Anfang 2024 lässt A die sanitären Anlagen (Badezimmer, Gästetoilette) für 29.750 Euro erneuern und neue Türen einbauen (11.900 Euro). Zudem beteiligt er sich an der Dachsanierung (14.280 Euro). Die gesamten Aufwendungen (55.930 Euro) macht er in 2024 als sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen geltend.
Lösung: Die Nettoaufwendungen ohne Umsatzsteuer (25.000 Euro + 10.000 Euro + 12.000 Euro = 47.000 Euro) überschreiten die 15 %-Grenze von 40.500 Euro (15 % von 270.000 Euro). Somit stellen die Aufwendungen insgesamt anschaffungsnahe Aufwendungen dar. Sie sind also nicht sofort im Jahr der Zahlung als Werbungskosten abzugsfähig, sondern erhöhen die Bemessungsgrundlage für die Gebäudeabschreibung von 270.000 Euro um 55.930 Euro auf 325.930 Euro. Dies gilt auch für die Kostenbeteiligung an der Dachsanierung, die als Aufwendungen für das Gemeinschaftseigentum ebenfalls im Rahmen der Ermittlung des insgesamt entstandenen Sanierungsaufwands mit einzubeziehen sind.
Aufwendungen für Sonder- und Gemeinschaftseigentum nicht aufzuteilen
Nach Ansicht des FG Hessen dürfen die auf das im Gemeinschaftseigentum stehenden Bestandteile des Gesamtgebäudes entfallenden Aufwendungen nicht unberücksichtigt bleiben. Dies würde auch dem (mit § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG verfolgten) Vereinfachungszweck widersprechen, weil sich Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen regelmäßig zugleich auf das Sondereigentum als auch auf Bereiche des Gemeinschaftseigentums beziehen. Eine Aufteilung von hierfür einheitlich getragenen Aufwendungen wäre oft nur unter größten Schwierigkeiten möglich.
Beachten Sie | Gegen die nicht zugelassene Revision wurde Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt.
Quelle | FG Hessen, Urteil vom 18.6.2024, 4 K 1736/19, NZB BFH, IX B 86/24, Abruf-Nr. 245150 unter www.iww.de
Keine außergewöhnlichen Belastungen:
Mitgliedsbeiträge für ein01 Fitnessstudio
| Aufwendungen für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio sind grundsätzlich nicht als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. Dies gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs (BFH) auch, wenn die Teilnahme an einem dort angebotenen, ärztlich verordneten Funktionstraining die Mitgliedschaft in dem Fitnessstudio voraussetzt. |
Hintergrund: Außergewöhnliche Belastungen wirken sich steuerlich nur aus, soweit die zumutbare Eigenbelastung überschritten wird. Deren Höhe hängt vom Gesamtbetrag der Einkünfte, Familienstand und von der Zahl der Kinder ab.
Das war geschehen
Der Steuerpflichtigen wurde ein Funktionstraining in Form von Wassergymnastik ärztlich verordnet. Sie entschied sich für das Training bei einem Reha-Verein, der die Kurse in einem für sie verkehrsgünstig gelegenen Fitnessstudio abhielt. Voraussetzung für die Kursteilnahme war neben dem Kostenbeitrag für das Funktionstraining und der Mitgliedschaft im Reha-Verein auch die Mitgliedschaft in dem Fitnessstudio. Letztere berechtigte die Steuerpflichtige aber auch zur Nutzung des Schwimmbads und der Sauna sowie zur Teilnahme an weiteren Kursen.
Die Krankenkasse erstattete nur die Kursgebühren für das Funktionstraining. Als Krankheitskosten und damit als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigte das Finanzamt nur die Mitgliedsbeiträge für den Reha-Verein.
Alle Instanzen sind sich einig
Einen Abzug der Mitgliedsbeiträge für das Fitnessstudio als außergewöhnliche Belastung lehnten das Finanzamt, das Finanzgericht (FG) Niedersachsen und auch der BFH ab.
Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio: frei gewähltes Konsumverhalten
Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio zählen grundsätzlich nicht zu den als außergewöhnliche Belastungen anzuerkennenden zwangsläufig entstandenen Krankheitskosten. Denn das mit der Mitgliedschaft einhergehende Leistungsangebot wird auch von gesunden Menschen beansprucht, z. B., um die Gesundheit zu erhalten und die Freizeit sinnvoll zu gestalten.
Die Mitgliedsbeiträge sind der Steuerpflichtigen auch nicht deshalb zwangsläufig erwachsen, weil sie dem Fitnessstudio als Mitglied beitreten musste, um an dem ärztlich verordneten Funktionstraining teilnehmen zu können.
Die Entscheidung, das Funktionstraining in dem Fitnessstudio zu absolvieren, ist in erster Linie Folge eines frei gewählten Konsumverhaltens, das nach Ansicht des BFH eine steuererhebliche Zwangsläufigkeit nicht begründen kann.
Zudem steht dem Abzug der Mitgliedsbeiträge entgegen, dass die Steuerpflichtige hierdurch die Möglichkeit erhielt, auch weitere Leistungsangebote (jenseits des medizinisch indizierten Funktionstrainings) zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn die Steuerpflichtige (wie von ihr vorgetragen) hiervon keinen Gebrauch gemacht hat.
Quelle | BFH, Urteil vom 21.11.2024, VI R 1/23, Abruf-Nr. 246107 unter www.iww.de, PM 5/25 vom 30.1.2025