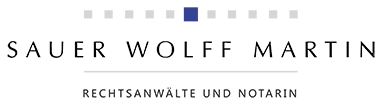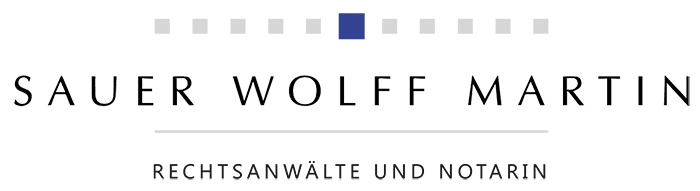Verkehrssicherungspflicht:
Beim Straßenumzug gestürzt: Klage gegen die Gemeinde ohne Erfolg
| Die auf Schadenersatz und Schmerzensgeld gerichtete Klage einer 66-jährigen Großmutter, die mit ihrem Enkelkind an einem Straßenumzug teilgenommen hatte und gestürzt war, hatte vor dem Landgericht (LG) Frankenthal keinen Erfolg. Das LG hat festgestellt: Die zuständige Gemeinde muss eine Straße wegen einer nur einmal jährlich stattfindenden Veranstaltung nicht besonders absichern. Es gelten vielmehr die üblichen Maßstäbe der Verkehrssicherungspflicht bei Straßen und Plätzen. |
Über Gullydeckel gestolpert
Die verletzte Frau gab an, bei einem Straßenumzug über einen bis zu drei Zentimeter über das Straßenniveau ragenden Gullydeckel gestolpert und gestürzt zu sein. Durch den Sturz habe sie sich das linke Handgelenk und das rechte Schultergelenk gebrochen. Sie war der Ansicht, vor dem Umzug hätte die zuständige Verbandsgemeinde die Strecke besonders kontrollieren und absichern, Stolpergefahren beseitigen und etwa den hochstehenden Gullydeckel mit einer Gummimatte sichern müssen. Sie verlangte rund 1.700 Euro Schadenersatz und ein Schmerzensgeld in Höhe von 13.000 Euro.
Mit Unebenheiten muss man rechnen
Das LG hat die Klage abgewiesen. Mit der Unebenheit von deutlich unter drei Zentimetern habe die Frau rechnen müssen. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung sei es auch jedem Teilnehmer bekannt und spätestens bei Beginn des Umzugs ersichtlich, dass die Sicht auf die Straße wegen der Menschenansammlung eingeschränkt sei. Eine besondere Absicherung der Straße aufgrund des einmal jährlich stattfindenden Großereignisses sei daher nicht geboten gewesen. Die Abdeckung des Gullydeckels mit einer Gummimatte hätte den Höhenunterschied und die Stolpergefahr möglicherweise nur zusätzlich erhöht. Im Übrigen treffe die Frau ein überwiegendes Mitverschulden, was die geltend gemachten Ansprüche ebenfalls ausschließe.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | LG Frankenthal, Urteil vom 15.8.2024, 3 O 88/24, PM vom 27.2.2025
Ordnungsmaßnahme:
Feuer entfacht in der Schul-Umkleide: Ausschluss von Skifahrt
| Ein Schüler, der sich in der Umkleidekabine der Schule daran beteiligt hat, ein Feuer zu entfachen, darf von der 13-tägigen Skifahrt nach Österreich ausgeschlossen werden. Diese schulische Ordnungsmaßnahme hat das Verwaltungsgericht (VG) Berlin gebilligt. |
Achtklässler warf Papier ins Feuer
Der 13-jährige Antragsteller ist Schüler einer 8. Klasse einer Berliner Schule. Im September 2024 beteiligte er sich während der Unterrichtszeit im Duschbereich der Umkleidekabine der Jungen an einem von zwei anderen Schülern entfachten Feuer, indem er selbst weiteres Papier ins Feuer warf. Dabei kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung.
Daraufhin beschloss die Klassenkonferenz noch im September 2024, den Antragsteller von der am 9.3.2025 beginnenden Skireise der 8. Jahrgangsstufen der Schule auszuschließen. Dagegen wandte sich der Antragsteller im gerichtlichen Eilverfahren. Es sei unverhältnismäßig, ihn von der Fahrt auszuschließen. Ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Brand und der Skifahrt sei nicht gegeben: Bei Beginn der Skifahrt werde sein Fehlverhalten bereits fünf Monate vergangen sein. Außerdem sei er nicht Haupttäter der Brandstiftung gewesen.
Verwaltungsgericht blieb hart
Dem folgte das VG nicht. Der Ausschluss sei rechtmäßig. Die Beteiligung an einer Brandstiftung während der Schulzeit gehe unzweifelhaft mit erheblichen Gefahren für Leib und Leben anderer einher. Sie beeinträchtige jedwede Unterrichts- und Erziehungsarbeit erheblich.
Es komme nicht darauf an, dass der Antragsteller die Gefahr angesichts des gewählten Brandortes offenbar für beherrschbar gehalten habe. Außerdem diene sein Ausschluss von der Reise auch deren Durchführbarkeit. Die Lehrkräfte seien bei der geplanten mehrtägigen Skifahrt mit ca. 130 Teilnehmenden darauf angewiesen, dass die Schüler und Schülerinnen klare Anweisungen befolgen, damit die Lehrkräfte die ihnen obliegende Aufsichtspflicht erfüllen und die Sicherheit für alle gewährleisten können. Angesichts der ungewohnten Umgebung und der besonderen Nähe, der die Schüler und Schülerinnen dort „rund um die Uhr“ untereinander ausgesetzt seien, komme es in besonders hohem Maße darauf an, dass undiszipliniertes Verhalten, das Personen und Sachen gefährden könne, unterbleibe.
Schüler hatte bereits „einiges auf dem Kerbholz“
Die Schule sei zu Recht davon ausgegangen, dass das Verhalten des Antragstellers die Annahme rechtfertige, dass er den reibungslosen Verlauf der Reise gefährden könne. Es sei auch nicht zu beanstanden, dass die ebenfalls an dem Feuer beteiligten Mitschüler im Gegensatz zum Antragsteller lediglich einen Verweis erhalten hätten. Ein Vergleich mit ihnen verbiete sich. Anders als sie habe der Antragsteller in der Vergangenheit wiederholtes Fehlverhalten gezeigt. Seit Herbst 2022 sei es an der Schule zu verschiedenen Vorfällen unter seiner Beteiligung gekommen, unter anderem wegen wiederholt körperlich und verbal übergriffigen Verhaltens gegenüber Mitschülern und Schulpersonal.
Quelle | VG Berlin, Beschluss 28.2.2025, VG 3 L 47/25, PM 15/25
Immobilienkaufvertrag:
Verkauf einer Immobilie: Veränderungen an der Statik sind dem Käufer mitzuteilen
| Werden in einem Wohnhaus tragende Wände entfernt und durch eine Stahlträgerkonstruktion ersetzt, muss dies einem potenziellen Käufer der Immobilie ungefragt mitgeteilt werden. Verschweigt der Verkäufer diesen Umstand, stellt dies eine arglistige Täuschung dar, die den Käufer zur Anfechtung des Kaufvertrags berechtigt. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken in einer aktuellen Entscheidung festgestellt und der Klage eines Ehepaars gerichtet auf die Rückabwicklung eines Immobilienkaufvertrags stattgegeben. |
Verkäufer verheimlichten Umbau
Ein Ehepaar aus Pirmasens entschloss sich, das von ihnen etwa 10 Jahre lang selbst bewohnte Wohnhaus zu verkaufen. Was es dem kaufinteressierten Ehepaar nicht erzählte, war, dass es vor einigen Jahren ihr Wohnzimmer vergrößert, und dazu durch eine im Ausland ansässige Firma tragende Trennwände im 1. OG des Hauses hatte entfernen lassen. Nach Entfernung der Wände wurde die Decke nur noch durch zwei Eisenträger gestützt, die direkt auf das Mauerwerk aufgelegt und zusätzlich durch Baustützen gestützt wurden, die eigentlich nur für den vorübergehenden Gebrauch gedacht sind. Diese Trägerkonstruktion wurde anschließend durch Verblendungen verdeckt und war nicht mehr ohne Weiteres sichtbar. Um einen Nachweis über die Statik hatten sich die Eigentümer im Nachgang nicht bemüht.
Käufer fochten Kaufvertrag erfolgreich an
Als die neuen Eigentümer dann selbst einige bauliche Veränderungen an dem Haus durchführen wollten, beauftragten sie u. a. einen Statiker. Dieser stellte fest, dass die Trägerkonstruktion im 1. OG unzulässig und nicht dauerhaft tragfähig sei. Das Ehepaar hat den Kaufvertrag über das Hausgrundstück daraufhin angefochten und das Verkäuferehepaar auf Rückabwicklung verklagt. Mit Erfolg.
Das OLG gab dem Käuferehepaar Recht und verurteilte die Verkäufer zur Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückübereignung des Hausgrundstücks. Die Verkäufer seien in der Pflicht gewesen, auch ungefragt darüber zu informieren, dass tragende Wände entfernt, und damit in die Statik des Wohnhauses eingegriffen wurde. Erst recht hätten sie darüber aufklären müssen, dass kein Nachweis hinsichtlich der statischen Tragfähigkeit der Stahlträgerkonstruktion vorliege. Auch sei darüber zu informieren gewesen, dass die Arbeiten durch eine den Verkäufern kaum bekannte ausländische Firma durchgeführt wurden und zu den genauen Maßnahmen keinerlei Unterlagen vorlägen. Dies alles gälte auch, obwohl die Verkäufer wohl selbst von der ausreichenden Tragfähigkeit der Konstruktion ausgingen und auch obwohl die Käufer das Haus vor dem Kauf zusammen mit einer Bausachverständigen besichtigt hatten. Die Statik eines Wohnhauses sei im Hinblick auf mögliche Gefahren für die Gebäudesubstanz und auch für Leib und Leben der Bewohner von so wesentlichem Interesse, dass eine Veränderung an ihr einem Grundstückserwerber in jedem Fall ungefragt zu offenbaren sei.
Quelle | OLG Zweibrücken, Urteil vom 27.9.2024, 7 U 45/23, PM vom 25.2.2025
Versicherungsvertrag:
Hinweis zur Widerspruchsbelehrung im Policenbegleitschreiben
| Hat der Versicherer im Policenbegleitschreiben auf das Bestehen eines Widerspruchsrechts und die hierfür geltenden Anforderungen allgemein hingewiesen und diese an einer genau bezeichneten Stelle im Einzelnen näher erläutert, sind die jeweiligen Textstellen nicht isoliert zu betrachten. Vielmehr ist dann eine Gesamtwürdigung beider Textstellen als einheitliche Belehrung geboten. So entschied das Oberlandesgericht (OLG) Saarbrücken. |
Begründung: Angesichts des konkreten Verweises auf die einschlägige Bestimmung in der Verbraucherinformation seien auch die dortigen weiteren Informationen für einen durchschnittlichen Versicherungsnehmer ohne Weiteres auffindbar. Im Fall des OLG galt dies insbesondere, da der Verbraucherinformation ein Inhaltsverzeichnis vorangestellt war. Aus dem ergab sich, dass die im Policenbegleitschreiben zitierte Textstelle „Können Sie nach Abschluss des Versicherungsvertrags dem Vertrag noch widersprechen?“ sich unter Ziffer 6 befindet, die ihrerseits auf der betreffenden Seite mit der fett gedruckten Überschrift „6. Können Sie nach Abschluss des Versicherungsvertrags dem Vertrag noch widersprechen?“ hervorgehoben war.
Quelle | OLG Saarbrücken, Urteil vom 22.1.2024, 5 U 60/23, Abruf-Nr. 246096 unter www.iww.de
Kindertageseinrichtung:
Beitragsbefreiung: Geschwisterregelungen beim Elternbeitrag gelten auch für Halbgeschwister
| Besuchen Halbgeschwister, die mit dem gemeinsamen Elternteil zusammenleben, gleichzeitig im Stadtgebiet Kindertageseinrichtungen, sind bei der Festsetzung von Elternbeiträgen hierfür satzungsrechtliche Geschwisterermäßigungen oder -befreiungen zu berücksichtigen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Halbgeschwister neben dem gemeinsamen Elternteil auch mit dem anderen Elternteil des einen Kindes in häuslicher Gemeinschaft zusammenleben. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster entschieden. |
Beitragsbefreiung oder nicht?
Die gemeinsame, im Juli 2019 geborene Tochter der Kläger nahm im Schuljahr 2021/2022 das Betreuungsangebot einer Kindertageseinrichtung in der beklagten Stadt wahr. Mit ihr und ihren Eltern lebte seinerzeit ein weiteres von der Klägerin, nicht aber vom Kläger abstammendes Kind in der gemeinsamen Wohnung, das dieselbe Kindertageseinrichtung besuchte, wofür wegen Vollendung des vierten Lebensjahres aufgrund einer landesrechtlichen Bestimmung kein Elternbeitrag zu leisten war. Die Stadt setzte gegenüber den Klägern auf Basis ihres gemeinsamen Jahreseinkommens einen monatlichen Elternbeitrag in Höhe von 313 Euro fest. Hiergegen wandten sich die Kläger und beriefen sich auf eine Vorschrift der Elternbeitragssatzung (im Folgenden nur: Satzung) der beklagten Stadt. Danach entfällt bei Eingreifen einer landesrechtlich für die letzte Zeit in Tagesbetreuung vor der Einschulung im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) angeordneten Beitragsbefreiung „auch der Beitrag für das zweite und jedes weitere Kind“. Diese Regelung folgt auf eine in sonstigen Fällen maßgebliche „Geschwisterregelung“ in der Satzung, wonach „nur ein Beitrag zu leisten“ ist, wenn „aus einer Familie […] mehr als ein Kind Betreuungsangebote […] in Anspruch“ nimmt.
Die auf Aufhebung der Beitragsfestsetzung gerichtete Klage wies das Verwaltungsgericht (VG) Arnsberg ab. Die dagegen eingelegte Berufung der Kläger hatte vor dem OVG Erfolg.
Gemeinsames Kind als weiteres Kind zu berücksichtigen
Das OVG hat zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentlichen angeführt: Das gemeinsame Kind der Kläger ist als weiteres Kind der Familie im Sinne der Geschwisterregelungen in der Satzung zu berücksichtigen. Die Gemeinschaft zweier leiblicher Kinder derselben Mutter mit dieser und deren neuem Partner, der Vater nur eines der beiden Kinder ist, ist unter Zugrundelegung eines verfassungsrechtlichen Begriffsverständnisses als eine Familie anzusehen. Ein anderes Verständnis des Familien- bzw. Geschwisterbegriffs lässt sich weder der städtischen Satzung noch höherrangigem Recht entnehmen. Die auf einer Ermächtigung des Landesgesetzgebers beruhende allgemeine Geschwisterregelung in der Satzung (bei mehreren Kindern nur ein Elternbeitrag) entspricht im Kern einer früheren landesgesetzlichen Regelung. Dieser lag allgemein eine Entlastung von Familien mit mehreren Kindern zugrunde, ohne dass etwa nach Voll- oder Halbgeschwistern unterschieden wurde. Bei dem Umstand, dass mehrere mit einem oder beiden Elternteilen in einem Haushalt zusammenlebende Kinder Angebote der Tagesbetreuung in Anspruch nehmen, für die jedenfalls der gemeinsame Elternteil grundsätzlich beitragspflichtig wäre, handelt es sich um einen Gesichtspunkt der sozialen Staffelung der Kostenbeiträge. Diese ist sowohl im Bundes- als auch im Landesrecht angelegt und ermöglicht neben der mit dem Einkommen korrespondierenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Beitragspflichtigen auch die Berücksichtigung anderer Aspekte, wie die Zahl der im gemeinsamen Haushalt lebenden und in Kindertageseinrichtungen zu betreuenden Kinder. Vor diesem Hintergrund kommt eine Differenzierung danach, dass beide Kläger für das mit ihnen zusammenlebende gemeinsame Kind beitragspflichtig sind, während das ältere Kind allein von der Klägerin abstammt und nur diese insoweit beitragspflichtig sein kann, nicht in Betracht.
Quelle | OVG Münster, Urteil vom 27.11.2024, 12 A 1627/22, PM vom 12.12.2024