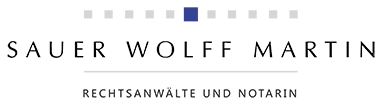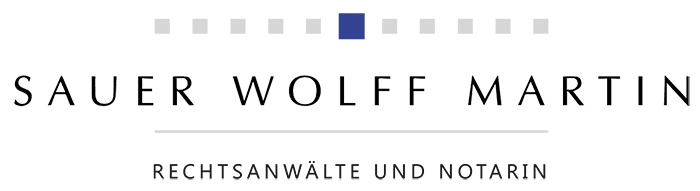Geschwindigkeitsüberschreitung:
Drei Verfassungsbeschwerden: Zugang zu Messdaten
| Der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) für das Land Baden-Württemberg hat über drei Verfassungsbeschwerden gegen Verurteilungen in Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenverfahren entschieden. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen die Beschwerdeführer in ihrem Recht auf ein faires Verfahren. Ihnen war die Einsicht in bei der Bußgeldbehörde vorhandene Daten der Geschwindigkeitsmessung und Unterlagen des Messgeräts, die nicht Teil der Bußgeldakte waren, versagt worden. Der VerfGH hat die Entscheidungen aufgehoben und die Sache jeweils zur erneuten Entscheidung an die Ausgangsgerichte zurückverwiesen. |
Das war geschehen
Den Beschwerdeführern wird vorgeworfen, als Kraftfahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten zu haben. Ihnen wurden deshalb zunächst mit Bußgeldbescheid und anschließend Urteil des Amtsgerichts (AG) Geldbußen zwischen 80 und 320 Euro zum Teil mit einmonatigem Fahrverbot auferlegt. Ihre dagegen beim Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart eingelegten Rechtsmittel blieben erfolglos. Während des Bußgeldverfahrens sowie des gerichtlichen Verfahrens begehrten die Beschwerdeführer wiederholt die Übermittlung von bei der Bußgeldbehörde vorhandenen, aber nicht bei der Bußgeldakte befindlichen Messdaten bzw. Wartungs- und Reparaturunterlagen des Messgeräts. Eine Einsicht wurde ihnen nicht bzw. nur unvollständig gewährt.
Wesentliche Erwägungen des Verfassungsgerichtshofs
Die Verfassungsbeschwerden sind, soweit die Beschwerdeführer eine Verletzung des Grundsatzes des fairen Verfahrens aufgrund der unterbliebenen Einsichtsgewährung in die begehrten Messdaten bzw. Wartungs- und Reparaturunterlagen rügen, zulässig und begründet. Wie das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bereits festgestellt hat, folgt aus dem Recht auf ein faires Verfahren grundsätzlich ein Anspruch auf Zugang zu den nicht bei der Bußgeldakte befindlichen, aber bei der Bußgeldbehörde vorhandenen Informationen.
Recht auf faires Verfahren
Hierbei handelt es sich nicht um eine Frage der gerichtlichen Aufklärungspflicht, sondern der Verteidigungsmöglichkeiten des Betroffenen. Der Beschuldigte eines Strafverfahrens bzw. Betroffene eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens hat neben der Möglichkeit, prozessual im Wege von Beweisanträgen oder Beweisermittlungsanträgen auf den Gang der Hauptverhandlung Einfluss zu nehmen, grundsätzlich auch das Recht, Kenntnis von solchen Inhalten zu erlangen, die zum Zweck der Ermittlung entstanden sind, aber nicht zur Akte genommen wurden. Dadurch werden seine Verteidigungsmöglichkeiten erweitert, weil er selbst nach Entlastungsmomenten suchen kann, die zwar fernliegen mögen, aber nicht schlechthin auszuschließen sind.
Die möglicherweise außerhalb der Verfahrensakte gefundenen entlastenden Informationen können von der Verteidigung zur fundierten Begründung eines Antrags auf Beiziehung vor Gericht dargelegt werden. Der Betroffene kann so das Gericht, das von sich aus diese Informationen nicht beizieht, auf dem Weg des Beweisantrags oder Beweisermittlungsantrags zur Heranziehung veranlassen.
Diesen Grundsätzen wurden die aufgehobenen Entscheidungen nicht gerecht.
Verhüllungsverbot:
Kein Gesichtsschleier am Steuer
| Eine Frau muslimischen Glaubens ist vor dem Verwaltungsgericht (VG) Berlin mit einer Klage gescheitert, mit der sie eine Ausnahmegenehmigung für das Führen eines Kraftfahrzeugs mit einem Gesichtsschleier erstreiten wollte. |
Nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen Personen, die ein Kraftfahrzeug führen, ihr Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass sie nicht mehr erkennbar sind (Verhüllungsverbot). Die Klägerin hatte geltend gemacht, ihr muslimischer Glaube gebiete es, dass sie sich außerhalb ihrer Wohnung nur vollverschleiert zeigen dürfe. Auch im Auto sei sie den Blicken fremder Menschen ausgesetzt. Daher müsse ihr erlaubt werden, beim Führen eines Kraftfahrzeugs ihren gesamten Körper einschließlich des Gesichts unter Aussparung der Augenpartie zu verschleiern. Ihren Antrag auf Erteilung einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung hatte das Land Berlin abgelehnt. Dagegen richtete sich die Klage.
Das VG hat die Klage abgewiesen. Eine Ausnahmegenehmigung könne die Klägerin auch mit Blick auf ihre grundrechtlich geschützte Religionsfreiheit nicht beanspruchen. Diese müsse nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen hinter anderen Verfassungsgütern zurücktreten. Das Verhüllungsverbot gewährleiste eine effektive Verfolgung von Rechtsverstößen im Straßenverkehr, indem es die Identifikation der Verkehrsteilnehmer ermögliche, etwa im Rahmen von automatisierten Verkehrskontrollen. Es diene zudem dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit und des Eigentums Dritter, weil Kraftfahrzeugführer, die damit rechnen müssten, bei Regelverstößen herangezogen zu werden, sich eher verkehrsgerecht verhalten würden als nicht ermittelbare Autofahrer.
Demgegenüber wiege der Eingriff in die Religionsfreiheit der Klägerin weniger schwer. Ein gleich wirksames, aber mit geringeren Grundrechtseinschränkungen verbundenes Mittel zur Erreichung der mit dem Verhüllungsverbot verfolgten Zwecke stehe nicht zur Verfügung. So könne etwa eine Fahrtenbuchauflage nur dem Halter eines Fahrzeugs auferlegt werden; die Klägerin begehre jedoch eine Ausnahme in ihrer Eigenschaft als Führerin eines Fahrzeugs. Gleichermaßen ungeeignet erscheine der Vorschlag der Klägerin, einen Niqab mit einem „einzigartigen, fälschungssicheren QR-Code“ zu versehen und die Ausnahme vom Verhüllungsverbot mit einer solchen Auflage zu verbinden. Denn dadurch sei nicht sichergestellt, dass die Person, die den Niqab trage, auch tatsächlich die Person sei, für die der QR-Code kreiert wurde.
Gegen das Urteil kann der Antrag auf Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg gestellt werden.
Quelle | VG Berlin, Urteil vom 27.1.2025, VG 11 K 61/24, PM 5/25
Motorradfahrer:
Wann ist ein Unfall unabwendbar?
| Ein Motorradfahrer wollte einen Auffahrunfall vermeiden. Er bremste deshalb sehr stark. Weil die Maschine kein Antiblockiersystem (ABS) hatte, blockierte das Vorderrad und der Motorradfahrer stürzte. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in diesem Fall kompakte Ausführungen zum „Idealfahrer“ hinsichtlich der Unabwendbarkeit gemacht. Besonders wichtig: Er bezieht die Situation vor dem Unfallgeschehen mit ein. |
Es kommt nicht nur auf die konkrete Situation an, …
Ob der Fahrer in der konkreten Gefahrensituation wie ein „Idealfahrer“ reagiert hat, ist nicht allein entscheidend. Vielmehr ist zu berücksichtigen, ob ein „Idealfahrer“ überhaupt in eine solche Gefahrenlage geraten wäre. Der sich aus einer abwendbaren Gefahrenlage entwickelnde Unfall wird nicht dadurch unabwendbar, dass sich der Fahrer in der Gefahr nun (zu spät) „ideal“ verhält. Der „Idealfahrer“ hat in seiner Fahrweise auch die Erkenntnisse berücksichtigt, die nach allgemeiner Erfahrung geeignet sind, Gefahrensituationen nach Möglichkeit zu vermeiden.
… sondern darauf, ob der Fahrer vorausschauend gehandelt hat
Dahinstehen kann also, ob der Sturz des Klägers noch im Zeitpunkt des Abbremsens durch kontrolliertes Betätigen der Vorderradbremse vermeidbar gewesen wäre. Denn ein Idealfahrer, der weiß, dass sein Motorrad nicht über ein ABS verfügt und bei einer reflexhaften Vollbremsung ein Sturz droht, hätte von vornherein eine Fahrweise gewählt, mit der ein reflexhaftes Bremsen in der Situation des Klägers vermieden worden wäre. Er hätte den Abstand zum Vorausfahrenden und die Geschwindigkeit so bemessen, dass er selbst im Fall plötzlich scharfen Bremsens des Vorausfahrenden das er stets einkalkulieren muss noch hätte kontrolliert bremsen und sowohl einen Sturz als auch eine Kollision mit dem Vorausfahrenden hätte vermeiden können.
Quelle | BGH, Urteil vom 3.12.2024, VI ZR 18/24, Abruf-Nr. 246125 unterwww.iww.de
Verkehrssicherungspflicht:
Karnevalsumzug: Aufstellen von mobilen Verkehrsschildern durch die Stadtverwaltung
| Werden anlassbezogen mobile Verkehrsschilder aufgestellt, muss der Umfang der Verkehrssicherungspflicht in einem angemessenen Verhältnis zu deren Funktion stehen. Daher hat das Landgericht (LG) Hanau entschieden, dass die Stadt für die Beschädigung eines Fahrzeugs, das über den auf die Fahrbahn gelangten Beschwerungsblock eines von ihr aufgestellten mobilen Verkehrsschilds fährt, nicht haftet. |
Aufgrund eines Karnevalsumzugs stellte die beklagte Stadt mobile Halteverbotsschilder auf. Der Kläger machte Schäden an seinem Fahrzeug geltend, die nach Veranstaltungsende durch das Überfahren eines am Fahrbahnrand liegenden Beschwerungsfußes eines dieser Schilder entstanden seien. Die Schilder hätten nach Veranstaltungsende wieder entfernt werden sollen, damit sie nicht auf die Fahrbahn geraten.
Das LG hat die Klage abgewiesen. Weil das Schild bzw. dessen Beschwerungsblock nicht von der Beklagten selbst in den Straßenraum verbracht wurde, würde die Stadt nur haften, wenn sie eine Verkehrssicherungspflicht verletzt hätte. Das sei jedoch nicht der Fall.
Der Verkehrssicherungspflichtige muss zwar erkennbaren Gefahren entgegenwirken, es können jedoch nicht alle erdenklichen Möglichkeiten einer Gefährdung Dritter ausgeschlossen werden. Zudem sind nur zumutbare Vorkehrungen zu treffen. Dass die für die Schilder verwendeten Betonblöcke mit einem Gewicht von 28 kg von selbst auf die Straße gelangen oder durch Dritte dorthin verbracht werden, ist zwar möglich, aber wenn auch vorliegend geschehen insgesamt wenig wahrscheinlich, zumal diese bei Einhaltung der an dem Unfallort vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h erkannt werden können. Demgegenüber müssen mobile Verkehrsschilder mit vertretbarem Aufwand transportiert werden können, um ihre Funktion zu erfüllen. Auch eine ständige Bewachung bis zum Abtransport sei nicht geboten.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | LG Hanau, Urteil vom 4.12.2024, 2 S 25/24, PM vom 17.2.2025