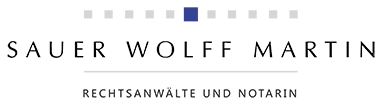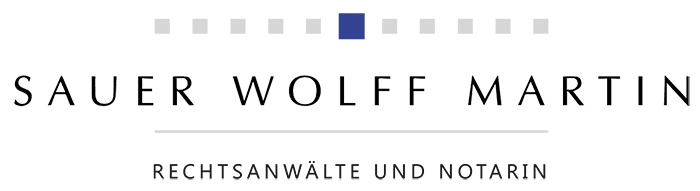Säumniszuschläge:
Spätestens seit März 2022 sind 12 % p. a. nicht zu beanstanden
| Säumniszuschläge werden festgesetzt, wenn die Zahlung nicht pünktlich erfolgt. Nach der Abgabenordnung (hier: § 240 AO) ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des rückständigen Steuerbetrags zu entrichten, umgerechnet auf das Jahr also 12 %. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass wegen des deutlichen und nachhaltigen Anstiegs der Marktzinsen, der seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 zu verzeichnen ist, jedenfalls seit März 2022 keine ernstlichen Zweifel mehr an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Zuschläge bestehen. |
Darüber hinaus hat der BFH in diesem Verfahren Folgendes entschieden: Wenn das Finanzamt zwar Aussetzung der Vollziehung (AdV) gewährt, deren Wirkung aber von der Erbringung einer Sicherheitsleistung abhängig macht, bewirkt die spätere Leistung der Sicherheit im Regelfall, dass die AdV mit (Rück-)Wirkung ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Verfügung eintritt und zuvor etwaig entstandene Säumniszuschläge entfallen.
Beachten Sie | Das Finanzamt kann allerdings ausdrücklich anordnen, dass die Wirkung der AdV erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Leistung der Sicherheit beginnt.
Quelle | BFH, Beschluss vom 21.3.2025, X B 21/25 (AdV)
Gesellschafter und Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften:
Organschaft im Zusammenhang mit atypisch stiller Beteiligung
| Eine atypisch stille Beteiligung an der Organgesellschaft steht der Anerkennung einer ertragsteuerrechtlichen Organschaft grundsätzlich nicht entgegen. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. |
Hintergrund: Eine Organschaft führt bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen dazu, dass nicht mehr die Organgesellschaft ihren Gewinn zu versteuern hat, sondern der Organträger.
Beachten Sie | Die gemäß Körperschaftsteuergesetz (hier: §§ 14 ff. KStG) enthaltenen Regelungen für die Organschaft führen im Ergebnis dazu, dass z. B. in Konzernen die Konzernspitze (als Organträger) die Gewinne sämtlicher Tochtergesellschaften (als Organgesellschaften) zu versteuern hat, aber Verluste und Gewinne der verschiedenen Tochtergesellschaften dabei auch unmittelbar miteinander verrechnet werden können. Insbesondere dieser steuerliche Vorteil hat zu einer weiten Verbreitung der Organschaft in Deutschland geführt.
Das war geschehen
Im Streitfall hatte eine Kommanditgesellschaft (KG) mit einer GmbH einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, um eine Organschaft zu begründen. Danach war die „abhängige“ GmbH als Organgesellschaft verpflichtet, den ganzen von ihr erwirtschafteten Gewinn an die KG als Organträger abzuführen.
Im Streitfall bestand die Besonderheit, dass an der GmbH als Organgesellschaft eine atypisch stille Beteiligung bestand.
Bundesfinanzhof widerspricht Vorinstanzen
Da dem atypisch still Beteiligten ein Anteil von 10 % des Gewinns der GmbH zustand, vertraten das Finanzamt und nachfolgend auch das Finanzgericht (FG) Mecklenburg-Vorpommern die Auffassung, dass lediglich 90 % des Gewinns an die KG als Organträger abgeführt worden sei, das Gesetz aber die Abführung des ganzen Gewinns fordere. Die Organschaft sei daher insgesamt nicht anzuerkennen. Dem ist der BFH aber nun entgegengetreten.
§ 14 Abs. 1 KStG setzt einen Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291 des Aktiengesetzes (AktG) und die strikte Erfüllung der zivilrechtlichen Vertragspflichten voraus. Was als ganzer Gewinn abzuführen ist, bestimmt sich nach dem Zivilrecht. Gewinnbeteiligungen, die einem stillen Gesellschafter zustehen, sind im Zivilrecht aber als Geschäftsunkosten vom Gewinn der GmbH abzusetzen. Dies betrifft sowohl die typische als auch die atypisch stille Gesellschaft.
Folglich ist der hiernach verbleibende „Rest-Gewinn“ (im Streitfall also die 90 %) der ganze Gewinn, der an den Organträger abgeführt werden muss. Dass eine (typische oder atypische) stille Beteiligung zivilrechtlich als Teilgewinnabführungsvertrag qualifiziert wird, steht dieser Beurteilung nicht entgegen.
Quelle | BFH, Urteil vom 11.12.2024, I R 33/22, Abruf-Nr. 247403; unterwww.iww.de; PM 21/25 vom 3.4.2025
Schadenersatz:
Unternehmen aufgepasst: Werklohnrechnungen gehackt und unbefugt verändert
| Wenn eine per E-Mail versandte Werklohnrechnung gehackt und unbefugt verändert wird und der Kunde deshalb an einen unbekannten Dritten zahlt, muss er nicht noch einmal an den Werkunternehmer zahlen, wenn dieser die Rechnung ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versandt hat und deshalb gegen ihn ein Schadenersatzanspruch gemäß Datenschutz-Grundverordnung (hier: Art. 82 DS-GVO) besteht. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig-Holstein klargestellt. |
Das war geschehen
Die Klägerin verlangt von der Beklagten, erneut ihre Werklohnforderung zu zahlen, nachdem der Betrag wegen einer Manipulation der per E-Mail versandten Rechnung durch kriminell handelnde Dritte dem Konto eines Unbekannten gutgeschrieben wurde.
Die Klägerin betreibt ein Unternehmen für die Installation von Haustechnik. Sie führte für die Beklagte Installationsarbeiten durch und rechnete die erbrachten Leistungen ihr gegenüber in drei Abschlagsrechnungen ab. Diese wurden jeweils als Anlage zu einer E-Mail im PDF-Format übersandt. Die ersten zwei Abschlagsrechnungen beglich die Beklagte per Überweisung an die auf den Rechnungen angegebenen Bankverbindungen der Klägerin.
Die dritte Abschlagsrechnung über rund 15.000 Euro, die zugleich die Schlussrechnung war, versandte die Klägerin ebenfalls als Anlage im PDF-Format per E-Mail. Diese Rechnung war jedoch auf ungeklärte Weise durch einen Dritten manipuliert worden, so dass die Beklagte den Rechnungsbetrag auf das Konto des unbekannten Dritten überwies. Auf dem Konto der Klägerin ging deshalb auf die Schlussrechnung keine Zahlung ein.
Keine Erfüllung durch Zahlung an unbekannten Dritten
Das Landgericht (LG) hat die Beklagte deshalb zur erneuten Zahlung verurteilt, weil eine Erfüllung durch die Zahlung an den unbekannten Dritten nicht eingetreten ist. Es hat ausgeführt, dass die Klägerin auch keine vertragliche Nebenpflicht verletzt hat, sodass die Beklagte keinen Schadenersatzanspruch hat, den sie der Klageforderung gemäß § 242 BGB entgegenhalten kann. Die Klägerin hat nach Auffassung des LG keine Pflichtverletzung begangen, weil die von ihr vorgetragenen Schutzvorkehrungen in Form einer Transportverschlüsselung per SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) über TLS (Transport Layer Security) beim E-Mail-Verkehr mit Vertragspartnern ausreichend sind.
So sah es das Oberlandesgericht
Das OLG hat in zweiter Instanz das Urteil des LG geändert und die Klage abgewiesen. Es hat entschieden, dass die Zahlung der Beklagten an einen Dritten zwar keine Erfüllung der Forderung bei der Klägerin bewirkt. Im Gegensatz zum Landgericht hat es jedoch einen Schadenersatzanspruch der Beklagten bejaht, den diese der Werklohnforderung der Klägerin nach § 242 BGB entgegenhalten kann, so dass sie die Forderung nicht noch einmal bezahlen muss.
Dieser Schadenersatzanspruch ergibt sich nach der Entscheidung des OLG aus Art. 82 Abs. 2 DS-GVO, weil die Klägerin im Zuge der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Beklagten bei Versand der streitgegenständlichen E-Mail mit Anhang gegen die Grundsätze der Art. 5, 24 und 32 DS-GVO verstoßen hat. Das OLG hält die Transportverschlüsselung, die beim Versand der streitgegenständlichen E-Mail in Form von SMTP über TLS verwendet worden sein soll, nicht für ausreichend und damit auch nicht als zum Schutz der Daten „geeignet“ im Sinne der DS-GVO.
Das OLG hob hervor, dass heute jedem Unternehmen, das personenbezogene Daten seiner Kunden computertechnisch verarbeitet, bewusst sein muss, dass der Schutz dieser Daten hohe Priorität auch beim Versenden von E-Mails genießt. Unternehmen müssen diesen Schutz durch entsprechende Maßnahmen so weit wie möglich gewährleisten.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unabdingbar
Gerade bei sensiblen oder persönlichen Inhalten ist nach der Entscheidung des OLG nur eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Schutz im Sinne der DS-GVO geeignet, wenn ein hohes finanzielles Risiko durch Verfälschung der angehängten Rechnung für den Kunden besteht. Dass Kunden von Unternehmen bei einem Datenhacking Vermögenseinbußen drohen, ist ein Risiko, das dem Versand von Rechnungen per E-Mail immanent ist und deshalb eine entsprechende Voraussicht und ein proaktives Handeln erfordert. Der dafür erforderliche technische und finanzielle Aufwand kann auch von einem mittelständischen Handwerksbetrieb erwartet werden, wenn es seine Rechnungen nicht per Post versendet.
Quelle | OLG Schleswig-Holstein, Urteil vom 18.12.2024, 12 U 9/24, PM 1/25