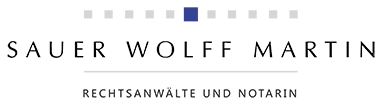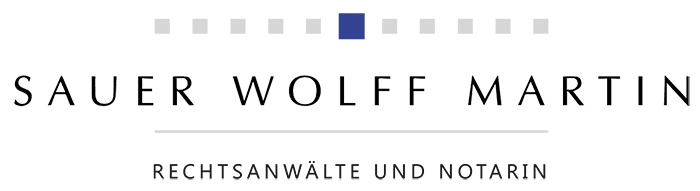Gesamtschuldner:
Jeder Wohnungseigentümer muss Straßenausbaubeitrag zahlen
| Bei der Festsetzung des Straßenausbaubeitrags handelt es sich um eine gemeinschaftliche Angelegenheit, die an alle Wohnungseigentümer in dieser Eigenschaft gerichtet ist. So entschied es das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster. |
Das OVG: Steht ein Grundstück im Miteigentum mehrerer Personen, wird der Vorteil allen (Mit-)Eigentümern gemeinsam geboten. Eine Beschränkung auf bestimmte Eigentumsanteile sei nicht möglich.
Da die Beitragspflicht im Grundstückseigentum und nicht in der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums beruht, ist nicht die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer beitragspflichtig, sondern jeder einzelne Wohnungseigentümer. Sie haften der Kommune gesamtschuldnerisch.
Quelle | OVG Münster, Urteil vom 18.2.2025, 15 A 454/23
Eigenbedarfskündigung:
Mieter muss Gesundheitsgefahr konkretisieren
| Das Amtsgericht (AG) Flensburg hat entschieden: Der Mieter muss gesundheitliche Beeinträchtigungen für sich oder die seine Mitbewohner und die nachteiligen Auswirkungen eines Umzugs durch Vorlage fachärztlicher Atteste ausführlich darstellen. Sein Vortrag muss so konkret sein, dass das Gericht den Eintritt von relevanten Nachteilen als hinreichend wahrscheinlich annehmen kann. Dann ist das Gericht gehalten, ein Sachverständigengutachten einzuholen. Der bloße unstreitige Umstand, dass die Kinder des Mieters einen Behindertenausweis und einen Pflegegrad zugesprochen bekommen haben, genügt nicht. Ohne Erläuterungen, welche Krankheiten oder Behinderungen die Kinder haben, kann das Gericht keinen Härtegrund annehmen. |
Der Vermieter kündigte den unbefristeten Wohnraummietvertrag wegen Eigenbedarf. Er begründete dies damit, er benötige das Objekt für sich und seine Lebensgefährtin als neuen Lebensmittelpunkt. Die Mieter widersprachen der Kündigung und berief sich insbesondere auf gesundheitliche Beeinträchtigungen. Die Mieterin leide an einer Angststörung und posttraumatischen Belastungsstörung und die beiden Kinder seien schwerbehindert und pflegebedürftig. Ein Umzug sei für die Familie unzumutbar.
Damit hatten sie vor dem AG keinen Erfolg. Das AG war nach der Zeugenvernehmung davon überzeugt, dass der Vermieter die Räume wegen der geplanten Familiensituation ernsthaft benötigte. Dass die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, seine Familie oder einen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist, erkannte das AG nicht an. Denn die Mieter seien ihrer Darlegungs- und Beweislast bezüglich der Härtegründe nicht nachgekommen.
Ein Härtegrund liege nur vor, wenn eine erhebliche Verschlechterung einer ernsten Erkrankung oder Lebensgefahr, die durch einen Sachverständigen zu klären ist, angenommen werden könne. Das Gericht hatte keine Anhaltspunkte, eine solche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Kinder der Mieter anzunehmen. Der vorgelegte Behindertenausweis, das Pflegegutachten und das allgemeinärztliche Attest sprächen nur unkonkret von einer „gesundheitlichen Situation“ des Kindes. Das war dem Gericht zu unkonkret. Es fehle insbesondere vertiefter Vortrag dazu, wie sich die Erkrankung im Alltag auswirke und inwieweit mit einer Verschlechterung der Situation durch einen Umzug zu rechnen sei.
Quelle | AG Flensburg, Urteil vom 4.12.2024, 61 C 55/24
WEG-Beschluss:
Kostenverteilung bei objektbezogener Kostentrennung
| Sieht die Gemeinschaftsordnung eine objektbezogene Kostentrennung vor, sodass nur die Wohnungseigentümer, deren Sondereigentum (bzw. Sondernutzungsrecht) sich in dem jeweiligen Gebäudeteil (bzw. in dem jeweiligen separaten Gebäude) befindet, die darauf entfallenden Kosten tragen müssen (hier: Kosten der Tiefgarage), gilt: Es widerspricht in der Regel ordnungsmäßiger Verwaltung, durch Beschluss auch die übrigen Eigentümer an den auf diesen Gebäudeteil (bzw. auf das separate Gebäude) entfallenden Erhaltungskosten zu beteiligen. Anders kann es nur liegen, wenn ein sachlicher Grund für die Einbeziehung der übrigen Wohnungseigentümer besteht. So hat es jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. |
Das war geschehen
Die Klägerin ist Mitglied der beklagten Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Zu der Anlage gehört eine Tiefgarage mit 15 Stellplätzen. Die Gemeinschaftsordnung als Bestandteil der Teilungserklärung aus dem Jahr 1971 ordnet die Nutzung der Stellplätze ausschließlich bestimmten Wohneinheiten zu. Die Einheit der Klägerin verfügt nicht über ein solches Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz. Zu den Kosten der Tiefgarage enthält die Gemeinschaftsordnung folgende Regelung: „Die Kosten für die Instandhaltung sowie Rücklagen für alle Fälle eventueller Erneuerungen und erforderlicher Reparaturen des gemeinschaftlichen Eigentums in und an der Garagenhalle einschließlich des Wagenwaschraumes werden im Verhältnis der Wohnungseigentümer ausschließlich von den Berechtigten der Einstellplätze im Garagentrakt […] gemeinsam getragen […].“
Das beschloss die Eigentümergemeinschaft
In einer Wohnungseigentümerversammlung wurde die Beauftragung einer Firma mit der Sanierung des Flachdachs oberhalb der Tiefgarage gemäß einem Angebot zu einem Preis von rund 427.500 Euro zuzüglich möglicher Preissteigerungen und die Beauftragung eines Ingenieurbüros mit den Baubetreuungsleistungen beschlossen. Die entstehenden Kosten sollten jeweils von sämtlichen Wohnungseigentümern nach Miteigentumsanteilen getragen werden. Zudem wurde beschlossen, dass der zur Finanzierung der Maßnahmen erforderliche Betrag zum Teil der Erhaltungsrücklage entnommen und im Übrigen eine Sonderumlage nach Miteigentumsanteilen erhoben werden soll. Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschlussmängelklage der Klägerin.
Vorinstanz ist nochmals gefragt
Der BGH: Nach neuem Recht ergibt sich aus dem Wohnungseigentumsgesetz (hier: § 16 Abs. 2 S. 2 WEG) die Kompetenz, abweichend von einer Vereinbarung die erstmalige Kostenbelastung von Wohnungseigentümern zu beschließen, ohne dass dabei wie zuvor nach altem Recht der Gebrauch oder die Gebrauchsmöglichkeit berücksichtigt werden muss. Damit ist zugleich die Frage aufgeworfen, inwieweit eine erstmalige Belastung zuvor von Kosten befreiter Wohnungseigentümer ordnungsmäßiger Verwaltung entsprechen kann. Das muss nun wieder die Vorinstanz prüfen.
Quelle | BGH, Urteil vom 14.2.2025, V ZR 236/23, Abruf-Nr. 246771 unter www.iww.de