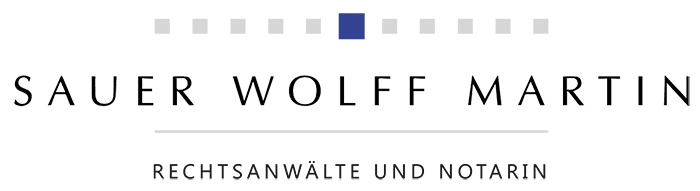Kostenübernahme:
Jobcenter muss keinen Stromzähler für Warmwasserboiler zahlen
| Das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen hat entschieden, dass für die Übernahme der Kosten eines separaten Stromzählers für die Warmwasserbereitung keine Rechtsgrundlage zulasten des Grundsicherungsträgers besteht. |
Das war geschehen
Ausgangspunkt war das Eilverfahren eines 63-jährigen Mannes. Beim Jobcenter legte er ein Angebot eines Elektrikers über den Einbau eines Drehstromzählers i.H.v. rd. 700 Euro vor. Er begehrte die Kostenübernahme, da die gesetzliche Warmwasserpauschale in seinem Fall nicht ausreiche. Nach der neuen Rechtslage ab 2021 könnten höhere Warmwasserkosten nur noch vom Jobcenter übernommen werden, wenn der Verbrauch durch einen Zähler nachgewiesen sei.
Keine Rechtsgrundlage für Kostenübernahme
Das Jobcenter lehnte den Antrag ab und führte zur Begründung aus, dass es an einer Rechtsgrundlage für einen solchen Kostenübernahmeanspruch fehle. Es handele sich weder um Kosten zur Sicherung des Lebensunterhalts noch um einen unabweisbaren Mehrbedarf. Demgegenüber hielt der Mann die Kosten für unabweisbar, da nun ein Nachweis über die Mehrkosten erforderlich sei und die pandemiebedingten Hygieneregeln einen erhöhten Bedarf erzeugten.
Händewaschen mit kaltem Wasser reicht aus
Das LSG hat die Rechtsauffassung des Jobcenters bestätigt. Aus materiellem Recht lasse sich kein Anspruch auf Zuschussleistungen für die Installation einer gesonderten Messeinrichtung herleiten. Der Gesetzgeber gehe davon aus, dass die Warmwasserpauschalen grundsätzlich auskömmlich seien. Voraussetzung für einen höheren Bedarf sei eine Messeinrichtung, wobei diese nach der gesetzlichen Konzeption jedoch nicht selbst ein Bedarf sei. Eine Regelung über Messeinrichtungen habe der Gesetzgeber in diesem Zusammenhang nicht getroffen, was jedoch zu erwarten gewesen wäre, wenn eine Kostenübernahme durch die Leistungsträger gewollt gewesen wäre. Außerdem ließen sich auch pandemiebedingt keine höheren Kosten herleiten, da nach den Hinweisen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kaltes Wasser zum Händewaschen ausreichend sei.
Quelle | LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 27.9.2022, L 11 AS 415/22 B ER, PM vom 24.10.2022
Wer haftet?:
Diebstahl von Koffern am Flughafen
| Das Landgericht (LG) Frankfurt am Main hat entschieden: Flugpassagiere können keinen Schadenersatz von der Betreiberin eines Flughafens verlangen, wenn ihre Koffer beim Entladen von Personen entwendet werden, die sich fälschlich als Flughafenangestellte ausgeben. |
Das war geschehen
Die Kläger waren im Februar 2020 mit einem Flug aus Bahrain in Frankfurt gelandet. Als ein Mitarbeiter der beklagten Flughafenbetreiberin das Gepäck entlud, kamen ihm zwei Männer in schwarzen Hosen und gelben Warnwesten zur Hilfe. Sie waren mit einem Kleinwagen zum Abfertigungsbereich gefahren, zu dem nur berechtigte Personen Zugang haben. Die beiden Männer veranlassten den Mitarbeiter der Flughafenbetreiberin, fünf Koffer von seinem Gepäckwagen abzuladen und nahmen sie mit. Die Kläger gaben an, es habe sich um ihre Koffer der Marke Louis Vuitton gehandelt. Darin hätten sich hochwertige Kleidungsstücke befunden. Der Gesamtwert habe rund 300.000 Euro betragen. Die Kläger hatten das Gepäck nicht gesondert versichert.
Ansprüche bestehen gegenüber der Fluggesellschaft…
In seinem aktuellen Urteil hat das LG die Schadenersatzklage der beiden Passagiere gegen die Flughafenbetreiberin abgewiesen: Ansprüche nach dem sog. Montrealer Übereinkommen hat es verneint. Nach diesem Regelwerk können derzeit maximal rund 1.600 Euro pro abhandengekommenem Koffer verlangt werden, jedoch nur von einer Fluggesellschaft. Zwar hatte die Airline im hiesigen Fall mit der beklagten Flughafenbetreiberin vereinbart, dass sie die Beförderung des Gepäcks am Boden übernimmt. „Das macht die Beklagte jedoch nicht zur Luftfrachtführerin im Sinne des Montrealer Übereinkommens“, so das LG.
… und nicht gegenüber der Flughafenbetreiberin
Auch andere, der Höhe nach nicht gedeckelte Schadenersatzansprüche stünden den Klägern nicht zu: Der Vertrag zwischen der Airline und der beklagten Flughafenbetreiberin über den Transport des Gepäcks am Boden habe keine Schutzwirkung zugunsten der Passagiere. Sie seien nicht schutzbedürftig, denn sie hätten bereits gegen die Fluggesellschaft einen Anspruch nach dem Montrealer Übereinkommen, weil ihnen die Koffer am Zielflughafen nicht ausgehändigt worden seien. Die Kläger müssten sich also nicht gegenüber der Flughafenbetreiberin schadlos halten.
Verkehrssicherungspflichten waren nicht verletzt
Die beklagte Flughafenbetreiberin habe auch keine Verkehrssicherungspflichten verletzt. So habe sie das Gepäck nicht unbeaufsichtigt an einem leicht zugänglichen Ort herumstehen lassen. „Die Diebe ließen sich vielmehr die Koffer durch geschickte Täuschung des Gepäckfahrers aushändigen, der die Koffer zuvor beim Ausladen im Blick (…) hatte. Aufgrund dieser unmittelbaren Kontrolle durch eine Person ist nicht ersichtlich, weshalb das Ausladen zusätzlich mit Kameras hätte überwacht werden sollen“, so das LG. Eine Videoüberwachung hätte den Diebstahl auch nicht verhindern können, da die Personen sich in Kleidung, Auftreten und Ausstattung in die übliche Mitarbeiterschaft einfügten. Schließlich könne der Flughafenbetreiberin auch nicht vorgehalten werden, sie hätte ihren Gepäckmitarbeiter nicht ordnungsgemäß ausgewählt und überwacht. Die Täter hätten sich trickreich verhalten, weil sie zunächst ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hätten und ihr Auftreten plausibel gewesen sei. Durch ein solches Vorgehen wäre nach Ansicht des LG auch ein noch so sorgfältig ausgewählter und angeleiteter Mitarbeiter überlistet worden.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Sie kann mit der Berufung zum Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main angefochten werden.
Quelle | LG Frankfurt am Main, Urteil vom 7.10.2022, 2-28 O 238/21, PM vom 4.11.2022
Bestattungsrecht:
Keine Genehmigung für privaten Bestattungsplatz
| Ein im Eifelkreis Bitburg-Prüm lebender Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung einer Genehmigung zur Anlage eines privaten Bestattungsplatzes für zwei Urnenbestattungen in der auf seinem Grundstück gelegenen Hofkapelle. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz. |
Das war geschehen
Der Kläger begründete seinen Wunsch, dass er und seine Ehefrau nach ihrem Tod in der ihnen gehörenden Hofkapelle, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite ihres Wohnhauses auf einem ihm gehörenden Grundstück befindet, im Rahmen einer Urnenbestattung beigesetzt zu werden, im Wesentlichen damit, dass die Kinder sich nicht um die Grabpflege auf dem örtlichen Friedhof kümmern könnten. Sie seien alle verzogen. Zudem laufe das Nutzungsrecht an der dort vorhandenen eigenen Grabstelle im Jahre 2030 aus. Zu der Hofkapelle bestehe ein besonderer persönlicher Bezug, weil der Patenonkel des Klägers diese erbaut habe. Seine Ehefrau und er lehnten eine Bestattung in der Grabstelle auf dem kommunalen Friedhof ab, da sich die Zeiten geändert hätten und sie über eine eigene Hofkapelle verfügten.
Das Verwaltungsgericht (VG) gab der Klage statt und verpflichtete den beklagten Kreis, dem Kläger die begehrte Genehmigung zur Anlage eines privaten Bestattungsplatzes für zwei Urnenbestattungen in der auf seinem Grundstück gelegenen Hofkapelle zu erteilen. Auf die Berufung des Beklagten hob das OVG das Urteil des VG auf und wies die Klage ab.
So argumentierte das Oberverwaltungsgericht
Die Anlage eines privaten Bestattungsplatzes bedürfe nach dem rheinland-pfälzischen Bestattungsgesetz BestG einer schriftlichen Genehmigung. Danach könnten private Bestattungsplätze nur angelegt werden, wenn ein berechtigtes Bedürfnis oder Interesse bestehe und öffentliche Interessen oder schutzwürdige Belange Dritter nicht beeinträchtigt würden. Hier erkannte das OVG kein solches berechtigtes Bedürfnis oder Interesse des Klägers.
Bei der Anerkennung einer Ausnahme im Einzelfall sei keine großzügige Handhabung geboten, um nicht einem Zustand Vorschub zu leisten, der zu einer Umkehrung des im Gesetz angelegten Regel-/Ausnahmeverhältnisses führte. Die vom Gesetzgeber angestrebte Wahrung der Totenruhe und die Wahrung des Wohls der Allgemeinheit ließen es nicht zu, im Fall des angestrebten privaten Bestattungsplatzes ein berechtigtes Bedürfnis oder Interesse schon anzuerkennen, wenn dies dem privaten Wunsch des Betroffenen entspreche. Mit dem grundsätzlichen Verbot von Bestattungen außerhalb von Friedhöfen werde der dem Gesetzgeber zustehende weite Ermessensspielraum aufgrund gewandelter Vorstellungen in der Bevölkerung nicht überschritten. Dies gelte auch dafür, dass die allgemeine Handlungsfreiheit des Einzelnen bei restriktiver Handhabung der Ausnahmevoraussetzungen, also der Genehmigungserteilung zwecks Aufrechterhaltung des im Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Regel-/Ausnahmeverhältnisses nur in besonders begründeten Einzelfällen, mittlerweile in nicht mehr vertretbarer Weise eingeschränkt werden könnte.
Wenngleich in einzelnen Bundesländern, wie etwa Nordrhein-Westfalen und Bremen, der Friedhofszwang für die Beisetzung von Aschenresten bereits vor geraumer Zeit gelockert worden sei, erachte es der weit überwiegende Teil offensichtlich weiterhin als geboten, sich insbesondere aus Gründen der Totenruhe und des sittlichen Gefühls weiter Bevölkerungskreise grundsätzlich für den Friedhofszwang zu entscheiden.
Persönliche Verbundenheit ist kein berechtigtes Interesse
Die persönliche Verbundenheit des Klägers zu der auf seinem Grundstück gelegenen und seit mehreren Jahrzehnten in seinem Eigentum stehenden Hofkapelle hier aufgrund der seinerzeitigen Errichtung durch seinen Patenonkel könne kein berechtigtes Interesse begründen, da ein gleichgelagerter Wunsch aufgrund einer besonderen persönlichen bzw. familiären Verbundenheit zu einem in seinem Eigentum stehenden Gebäude bei jedem anderen Grundstückseigentümer ebenso vorliegen könnte.
Soweit das VG hervorgehoben habe, der Kläger verfüge mit seiner Hofkapelle über einen Ort, der für eine Urnenbeisetzung besonders geeignet sei und in der die Beisetzung in angemessener und pietätvoller Weise durchgeführt werden könne, sei dem in diesem Zusammenhang keine ausschlaggebende Bedeutung beizumessen.
Quelle | OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 6.10.2022, 7 A 10437/22.OVG, PM 15/22
Tierhalterhaftung:
Wenn ein Hund den anderen beißt …
| Der Halter eines angeleinten Weimaraners muss sich die eigene sog. Tiergefahr nicht schadensmindernd anrechnen lassen, wenn sein Hund ohne vorheriges auffallendes Verhalten von einem sich losreißenden Rottweiler gebissen wird. Die Tiergefahr des Halters des Weimaraners tritt vollständig hinter die Tiergefahr des Halters des Rottweilers zurück, betonte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main und bestätigte die landgerichtliche Verurteilung zur Zahlung von Schadenersatz. |
Das war geschehen
Hundehalter A. ging Anfang März 2018 gegen 20 Uhr mit seinem Weimaraner Rüden in der Umgebung von Mainz spazieren. Er begegnete Hundehalterin B. und ihrem Rottweiler. Ob der Rottweiler den Weimaraner biss, ist zwischen den Parteien streitig. Im Anschluss an die Begegnung wurde der Hund des A. über einen Monat hinweg tierärztlich behandelt. A. verlangte von B. Ersatz der Tierarztkosten in Höhe von knapp 3.000 Euro, 1.000 Euro Schmerzensgeld sowie Verdienstausfall infolge der Betreuung des Hundes, insgesamt gut 5.000 Euro. Er behauptete, der Rottweiler habe sich losgerissen, ihn umgeworfen und seinen Hund durch Bisse in den Hals verletzt. B. behauptet, die jeweils angeleinten Hunde hätten lediglich kurze Zeit „Schnauze an Schnauze“ gestanden.
Sachverständigengutachten: Tierhalterhaftung bei Rottweiler-Besitzerin
Das Landgericht (LG) hat der Klage von über 3.000 Euro stattgegeben. Das OLG maß der hiergegen von B. eingelegten Berufung keinen Erfolg zu. Das LG habe auf Grundlage der Parteiangaben und des eingeholten Sachverständigengutachtens für das Berufungsverfahren bindend eine Haftung der B. über die Grundsätze der Tierhalterhaftung angenommen. Der Rottweiler habe den Weimaraner angegriffen. Der Weimaraner habe keine aggressiven Handlungen ausgeführt; insbesondere habe er vor der Attacke nicht gebellt.
A. müsse sich auch keine eigene Tierhaftung schadensmindernd anrechnen lassen. Vielmehr trete diese Tiergefahr, so das OLG, hinter die des Rottweilers vollständig zurück. Die Tiergefahr des Rottweilers überwiege die des Weimaraners schon deshalb, da dieser den Weimaraner angegriffen habe.
Rottweiler ist „gefährlicher Hund“ nach der Hundeverordnung
Weiter vertieft das OLG: „Hinzu kommt, dass es sich (nur) bei dem Rottweiler um einen gefährlichen Hund im Sinne der hessischen Hundeverordnung (§ 2 Abs. 1 HundeVO Hessen) handelt, der Hund also schon grundsätzlich als mensch- bzw. tiergefährdend anzusehen ist“. Soweit B. den Charakter des Hundes als ungefährlich „gutmütig“ und „lieb“ beschrieben habe, stehe das im Widerspruch zum streitgegenständlichen Vorfall. Schließlich erlange Bedeutung, dass nur B. und nicht A. die Kontrolle über das jeweils geführte Tier verloren hätten. B. sei damit der nach der Verordnung bestehenden Verpflichtung nicht gerecht geworden, das Tier so zu führen, dass von ihm keine Gefahr für Leben oder Gesundheit für Menschen oder Tiere ausgehe. „Es wäre Sache der Beklagten (…) gewesen, jedes Zulaufen des Rottweilers auf A. und seinen Hund zu verhindern“, betont das OLG abschließend.
Das landgerichtliche Urteil ist nun rechtskräftig.
Quelle | OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 25.8.2022, 11 U 34/21, PM vom 1.11.2022