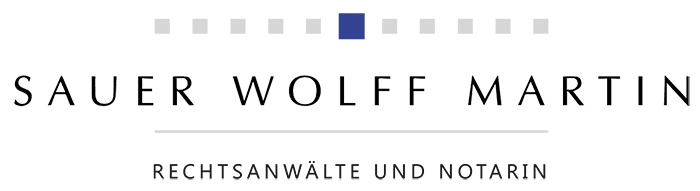Hausratsteilung:
Trennung und Scheidung – wer bekommt den Hund?
| Auch wenn ein Hund als „Hausrat“ einzuordnen ist, gelten für ihn bei der Hausratsteilung besondere Regeln. |
Das folgt aus einem Rechtsstreit zweier Eheleute vor dem Oberlandesgericht (OLG) Osnabrück. Die beiden hatten den Hund „Dina“ im Juni 2013 erworben. Anfang Januar 2016 trennten sie sich. Die Ehefrau verzog nach Schleswig-Holstein. „Dina“ verblieb zunächst beim Ehemann in Osnabrück. Im Jahr 2018 wollte die Ehefrau vor Gericht von ihrem Ehemann die Herausgabe des Hundes erstreiten.
Die Richter am OLG sahen dafür jedoch keine Erfolgsaussichten. Der Hund sei zwar grundsätzlich als „Hausrat“ einzuordnen, der nach Billigkeit zu verteilen ist. Bei der Zuteilung müsse aber dem Umstand Rechnung getragen werden, dass es sich um ein Lebewesen handelt. Das gesetzgeberische Bekenntnis zum ethisch fundierten Tierschutz müsse berücksichtigt werden. Dabei sei insbesondere darauf Rücksicht zu nehmen, dass Hunde Beziehungen zu Menschen aufbauen und unter dem Verlust eines Menschen leiden könnten. Es sei daher darauf abzustellen, wer den Hund in der Vergangenheit überwiegend versorgt, gepflegt und beschäftigt hat, wer also die Hauptbezugsperson des Tieres sei. Im konkreten Fall war dies nach der Auffassung des Senats der Ehemann – und zwar unabhängig von der Frage, wer sich während der Ehezeit besonders um „Dina“ gekümmert hatte. Denn das Tier lebe jetzt schon seit über 2 1/2 Jahren beim Ehemann. Daher sei davon auszugehen, dass dieser sich zur Hauptbezugsperson des Hundes entwickelt habe. Eine Trennung vom Ehemann erscheine daher mit dem Wohl des Tieres nicht vereinbar, zumal Mängel in der Versorgung des Hundes nicht erkennbar seien. Die Ehefrau könne „Dina“ daher nicht herausverlangen.
Quelle | OLG Oldenburg, Beschluss vom 16.8.2018, 11 WF 141/18, Abruf-Nr. 206712 unter www.iww.de.
Kindesunterhalt:
Für den Besuch einer Privatschule gibt es nicht automatisch mehr Unterhalt
| Der Kindesunterhalt, den der Partner, bei dem das Kind nach einer Trennung lebt, von dem anderen Elternteil fordern kann, wird zumeist nach der sogenannten „Düsseldorfer Tabelle“ berechnet. Manchmal kommt der betreuende Elternteil mit diesem Geld nicht aus, wenn Kosten außer der Reihe anfallen, zum Beispiel Kosten für den Nachhilfeunterricht, den Kindergarten, Reitstunden oder eine Therapie. Man spricht dann von „Mehrbedarf“. Die Gerichte müssen im Einzelfall prüfen, ob dieser Mehrbedarf eine zusätzliche Unterhaltsverpflichtung auslöst. Das ist nur der Fall, wenn es für den Mehrbedarf sachliche Gründe gibt oder der andere Elternteil mit den Zusatzausgaben einverstanden ist. |
Das OLG Oldenburg hatte in einem aktuellen Fall über solchen Mehrbedarf zu entscheiden. Die Kindesmutter war nach der Trennung mit der Tochter aus Ostdeutschland nach Oldenburg umgezogen. Sie verlangte vom Kindesvater zusätzlichen Unterhalt für die Kosten, die dadurch entstehen, dass das Mädchen hier eine Privatschule besucht. Das Kind sei durch die Trennung und den Umzug belastet. Daher sei die geringere Klassengröße einer Privatschule vorzugswürdig und für die Integration in das neue Lebensumfeld wichtig.
Der Senat bestätigte die Entscheidung des Amtsgerichts, das eine Erhöhung der Unterhaltsverpflichtung abgelehnt hatte. Auch wenn die Eltern sich während der Zeit des Zusammenlebens dafür entschieden hätten, dass die Tochter eine Privatschule besuchen solle, könne hieraus keine dauerhafte Zustimmung abgeleitet werden. Mit der Trennung und insbesondere mit dem Umzug nach Oldenburg sei eine ganz neue Situation entstanden. Es gebe auch keinen sachlichen Grund für den Besuch einer Privatschule. Die Integration im neuen Lebensumfeld könne auch auf einer kostenfreien staatlichen Schule gefördert werden. Auch das Argument der Mutter, die Tochter müsse bei Versagung des Unterhalts jetzt erneut einen Schulwechsel verkraften, fruchtete nicht. Die von der Mutter durch die Einschulung auf der Privatschule geschaffene Tatsache könne die Schulwahl nicht nachträglich rechtfertigen. Zu berücksichtigen sei schließlich auch, dass beide Eltern in beengten finanziellen Verhältnissen lebten.
Quelle | OLG Oldenburg, Beschluss vom 26.7.2018, 4 UF 92/18, Abruf-Nr. 206711 unter www.iww.de.
Patientenverfügung:
Notwendiger Inhalt der Patientenverfügung, um lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen
| Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit den Anforderungen befasst, die eine Patientenverfügung im Zusammenhang mit dem Abbruch von lebenserhaltenden Maßnahmen erfüllen muss. |
Die Richter erläuterten, dass grundsätzlich das Betreuungsgericht den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen genehmigen muss. Diese Gerichtsentscheidung ist jedoch nicht erforderlich, wenn der Betroffene einen entsprechenden eigenen Willen bereits in einer wirksamen Patientenverfügung niedergelegt hat und diese auf die konkret eingetretene Lebens- und Behandlungssituation zutrifft. Wird das Gericht dennoch angerufen, weil eine der beteiligten Personen Zweifel an der Bindungswirkung einer Patientenverfügung hat und kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass eine wirksame Patientenverfügung vorliegt, die auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutrifft, hat es auszusprechen, dass eine gerichtliche Genehmigung nicht erforderlich ist (sogenanntes Negativattest).
Eine Patientenverfügung entfaltet allerdings nur unmittelbare Bindungswirkung, wenn sich feststellen lässt, in welcher Behandlungssituation welche ärztlichen Maßnahmen durchgeführt werden bzw. unterbleiben sollen. Die Anforderungen an die Bestimmtheit einer Patientenverfügung dürfen dabei jedoch nicht überspannt werden. Vorausgesetzt werden kann nur, dass der Betroffene umschreibend festlegt, was er in einer bestimmten Lebens- und Behandlungssituation will und was nicht. Maßgeblich ist nicht, dass der Betroffene seine eigene Biografie als Patient vorausahnt und die zukünftigen Fortschritte in der Medizin vorwegnehmend berücksichtigt. Nicht ausreichend sind jedoch allgemeine Anweisungen, wie die Aufforderung, ein würdevolles Sterben zu ermöglichen oder zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zu erwarten ist. Auch die Äußerung, „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen, enthält jedenfalls für sich genommen keine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung.
Werden bestimmte ärztliche Maßnahmen wenig detailliert benannt, kann der Wille des Betroffenen dadurch konkretisiert werden, dass er auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen Bezug nimmt. Ob seine Patientenverfügung in solchen Fällen hinreichend konkret ist, muss dann durch Auslegung der in der Patientenverfügung enthaltenen Erklärungen ermittelt werden.
Quelle | BGH, Beschluss vom 14.11.2018, XII ZB 107/18, Abruf-Nr. 206166 unter www.iww.de.