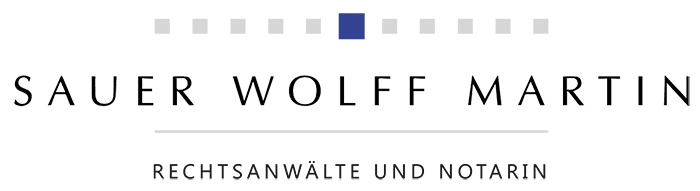Namensrecht:
Voraussetzungen für die Änderung des Familiennamens eines Pflegekindes
| Der Familienname eines Kindes kann in den Namen der Pflegeeltern geändert werden, wenn dies dem Wohl des Kindes förderlich ist. |
Dies entschied das Verwaltungsgericht (VG) Mainz im Fall eines heute 10-jährigen Kindes, das seit seiner Geburt bei Pflegeeltern lebt. Es trägt den Familiennamen der leiblichen Mutter. Auf Wunsch des Kindes und im Einverständnis mit den Pflegeeltern gab die zuständige Verbandsgemeinde dem Antrag auf Änderung des Familiennamens des Kindes in den der Pflegeeltern statt. Sie führte aus, dass eine Namensänderung zur dauerhaften Sicherung des Wohls des Kindes erforderlich sei. Dagegen richtete sich die Klage des leiblichen Vaters. Er sieht die Interessen der leiblichen Eltern unnötig zurückgesetzt. Eine Namensänderung sei nicht notwendig, um seinem Kind Sicherheit zu vermitteln. Sie schade vielmehr der Bindung zwischen den leiblichen Eltern und dem Kind.
Das VG wies die Klage des leiblichen Vaters ab. Nur ein wichtiger Grund rechtfertige es, den Familiennamen zu ändern. Ob ein solcher vorliege, müsse durch eine Abwägung aller Umstände des Falls geklärt werden. Erforderlich sei, dass sich ein Übergewicht der für die Änderung sprechenden Belange ergebe. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits für den Fall entschieden, dass ein Kind in Dauerpflege aufwächst. Nach der Rechtsprechung ist es notwendig, aber auch ausreichend, dass die begehrte Namensänderung dem Wohl des Pflegekindes förderlich sei. Weiterhin dürften überwiegende Interessen an der Beibehaltung des bisherigen Namens nicht entgegenstehen.
Im vorliegenden Fall bestehe eine intensive Beziehung des Kindes zu den Pflegeltern. Die gelte es auch zukünftig zu stabilisieren. Das Interesse des leiblichen Vaters trete dahinter zurück. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass das Kind schon bisher einen anderen Familienname trage als sein Vater.
Quelle | VG Mainz, Urteil vom 24.4.2015, 4 K 464/14, Abruf-Nr. 144716 unter www.iww.de.
Gesetzliche Krankenversicherung:
Berücksichtigung einer Unterhaltsabfindung bei der Beitragsbemessung der gesetzlichen Krankenversicherung
| Die Abfindungszahlung eines nachehelichen Unterhaltsanspruchs ist bei der Bemessung der Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht auf 12 Monate, sondern auf 10 Jahre zu verteilen. |
So entschied es das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen im Fall einer Frau, die zunächst über ihren Ehemann in der gesetzlichen Krankenkasse familienversichert war. Nach rechtskräftiger Scheidung ihrer 22-jährigen Ehe beantragte sie die Aufnahme als freiwilliges Mitglied. Sie hatte nach der Scheidung von ihrem geschiedenen Ehemann einen Abfindungsbetrag für den nachehelichen Unterhaltsanspruch in Höhe von 35.000 EUR erhalten. Die Krankenkasse berücksichtigte die Abfindungszahlung bei der Festsetzung der Höhe der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Sie legte diese auf zwölf Monate um, in dem sie von beitragspflichtigen monatlichen Einnahmen in Höhe von 2.916,67 EUR ausging. Hiergegen wandte sich die Frau. Da sie sich ihren kompletten Unterhaltsanspruch habe abfinden lassen, sei die Abfindungszahlung zumindest auf 10 Jahre umzulegen.
Das Sozialgericht hat die Krankenkasse verurteilt, die Höhe des Gesamtbeitrags zur Kranken- und Pflegeversicherung auf der Grundlage der Mindestbeitragsbemessungsgrenze festzusetzen. Zwar sei nach § 5 Abs. 3 der Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler eine einmalige beitragspflichtige Einnahme dem jeweiligen Beitragsmonat mit 1/12 zuzuordnen. Da mit der Zahlung der Abfindung die nachehelichen Unterhaltsansprüche vollständig abgegolten wurden, sei jedoch eine Umlegung auf zwölf Monate nicht gerecht. Die Abfindung sei vielmehr mit einem Versorgungsbezug oder einer Kapitalabfindung vergleichbar, sodass sie entsprechend der Regelung des § 5 Abs. 4 der Beitragsverfahrensgrundsätze auf 120 Monate (10 Jahre) umzulegen sei.
Das LSG hat diese Entscheidung bestätigt. Bei der Bemessung der Beiträge für freiwillige Mitglieder sei die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen. Tatsächlich nicht erzielte Einnahmen dürften nicht fingiert werden. Die Beitragsverfahrensgrundsätze sähen für die streitige Abfindung eines nachehelichen Unterhalts keine passende Regelung vor. Die Beurteilung als einmalige Einnahme mit einer Zuordnung von 1/12 würde zu einer unangemessenen Schlechterstellung der Frau gegenüber Personen führen, die ihren nachehelichen Unterhalt regelmäßig monatlich über einen längeren Zeitraum erhalten. Daher bestimme der Zufluss der 35.000 EUR entgegen der Ansicht der Krankenkasse nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Klägerin für ein Jahr, sondern ersetze den Unterhaltsanspruch mehrerer Jahre, also eine monatlich regelmäßig wiederkehrende Leistung. Versorgungsbezüge, die ebenfalls eine Einkommens- oder Unterhaltsersatzfunktion hätten, würden auf 10 Jahre verteilt. Daher sei auch die Verteilung der Abfindung auf 10 Jahre angemessen.
Quelle | LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 29.1.2015, L 1/4 KR 17/13, Abruf-Nr. 144495 unter www.iww.de.